Presseberichte 2018
- Ein Mensch ist immer ein Mensch (Gedenkfeier sm 27. Januar 2018)
- Granaten, Splitter, Sprengstoff
- Handlungsbedarf (Kommentar von W. Haserer)
- Kein Leben mit Hass im Herzen (Abba Naor)
- Historische Baustellen
- Das vergessene Lager (SZ, 3.4.2018)
- Ein Hauch Genugtuung
- Ein sichtbares Zeichen im Wald
- Erfolg einerr breiten Bewegung (Kommentar von W. Haserer)
- Hoffnung für den Bunkerbogen
- Gedenkorte im Mühldorfer Hart der Öffentlichkeit übergeben (Stiftung bayerischer Gedenkstätten)
- Die Rechnung geht an den Bund (Kampfmittelräumung)
ana, 20.1.2018
Auszeichnung für jahrzehntelange Kindergrabpflege
Bündnis für Demokratie und Toleranz würdigt Burgkirchner Initiative als vorbildlich -1000 Euro Preisgeld

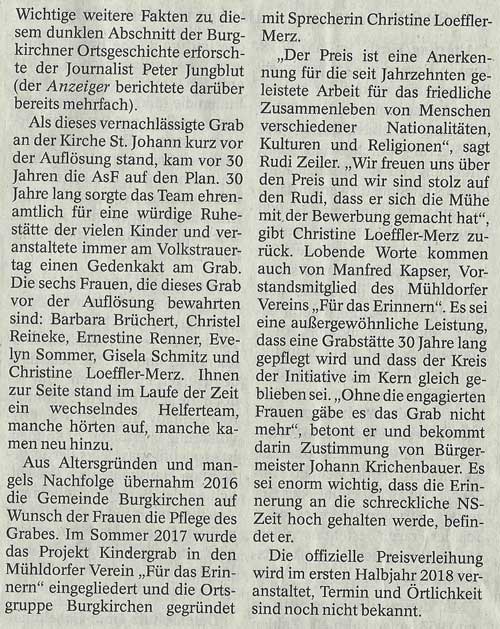
ERINNERUNG AN DIE OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS
Ein Mensch ist immer ein Mensch

Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am Samstag haben Menschen aus der Region insbesondere der Menschen gedacht, die in den KZ-Außenlagern im Landkreis ermordet wurden. Im KZ-Friedhof in Mühldorf legten Vertreter aus Politik und der Kirchen einen Kranz nieder.
Mühldorf – Der stellvertretende Landrat, Alfred Lantenhammer, sagte in seiner Rede, er habe ein Interview mit einer Frau gesehen, die das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat. Sie habe sich die Frage gestellt, wie Menschen etwas so Unmenschliches tun könnten. Lantenhammer arbeitete heraus, dass das Nazi-Regime gegen Menschen gehetzt und Hass geschürt habe. Und eben dieser Hass habe Gewalt erzeugt. „Gibt es nicht bei uns auch solches Tun? Die Antwort kennen Sie“, spann er den Bogen in die Gegenwart. Wir hätten es in der Hand, aus der Vergangenheit zu lernen. Das Gedenken sei deshalb wichtig.
Mühldorfs Zweite Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sontag erinnerte daran, wer auf dem KZ-Friedhof in Mühldorf bestattet worden sei, und unter welchen Umständen. Die hauptsächlich aus Ungarn stammenden Juden waren nach Kriegsende aus Massengräbern bei Mettenheim und damit unweit des KZ-Außenlagers im Mühldorfer Hart exhumiert worden.
Am 28. Juni 1945 waren sie in würdigen Friedhöfen bestattet worden. Die Zweite Mühldorfer Bürgermeisterin rief in Erinnerung, dass auf Anordnung der US-Militärregierung die Menschen aus der Region bei dieser Bestattung dabei sein mussten. Auch ihre Mutter, berichtete Preisinger-Sontag, damals elf Jahre alt, habe diese Beerdigungen miterlebt. Dieser Teil der Geschichte zeige, wie einfach es war, „aus Mitmenschen Gegenmenschen zu machen“.
Pater Ulrich Bednara stellte anhand einer Stelle des Alten Testaments die Frage, ob Gewalt mit Gegengewalt beantwortet werden solle. „Auch wir sind nicht immer gut und friedlich“, mahnte er. Er forderte dazu auf, sich damit auseinanderzusetzen, was früher war. Pfarrerin Susanne Vogt nahm Bezug auf einen Rabbiner, der Ausschwitz überlebte und über einen Psalm die Antwort gefunden habe, welche Aufgabe ihm durch dieses Überleben gegeben sei. Er habe das Gespräch zu den Nachkommen der Täter gesucht. Vogt formulierte es so: „Erinnerung macht Sinn, wenn auch Begegnung stattfindet.“ Nur dann könnten wir begreifen, dass ein Mensch immer ein Mensch sei.
9.3.2018, ovb
KAMPFMITTEL UND ALTLASTEN AM BUNKERGELÄNDE IM MÜHLDORFER HART
Granaten, Splitter, Sprengstoff
In zwei Monaten werden im Mühldorfer Hart die ersten beiden Teile der KZ-Gedenkstätte eingeweiht. Während am ehemaligen Waldlager und Massengrab die Arbeiten auf Hochtouren laufen, haben die Planungen für die zentrale Gedenkstätte am Bunkerbogen einen herben Rückschlag erlitten. Der Grund: Kampfmittel und Altlasten im Boden.

Mühldorf – Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten hatte das Staatliche Bauamt Rosenheim beauftragt, im Bereich des geplanten dritten Gedenkortes am Bunkerbogen Bodenuntersuchungen auf Kampfmittel durchführen zu lassen. Die Ergebnisse offenbaren ein Problem, das den Bau der zentralen Gedenkstätte um weitere Jahre verzögern könnte.
„Wir haben Bombensplitter, Granaten und TNT-Reste gefunden“, erklärt Geologe Lutz Opper, der die Testfelduntersuchungen als Gutachter begleitet hat. In seinen Augen seien die Funde „nichts Außergewöhnliches, wenn man die Geschichte des Ortes kennt“. Das Bunkergelände war nach dem Krieg als Sprengplatz genutzt worden, auf dem Tausende Tonnen Munition vernichtet wurden (siehe Bericht unten). Außergewöhnlich, so Opper, sei die Dimension des Ortes: „Über 100 Sprengtrichter auf so einer großen Fläche: Das ist mit Blick auf eine Räumung natürlich eine Herausforderung“, sagt Opper. Das Gefährdungspotenzial schätzt der Experte aktuell als gering ein. „Durch die spätere Verfüllung der Trichter muss man heute schon sehr tief graben, um auf die Kampfmittel zu stoßen.“ Zudem habe man bisher nur detonierte Granaten entdeckt.
Laut Ulrich Fritz von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten wären nach aktuellem Stand die meisten Funde „nur dann gefährlich, wenn sie im Rahmen von Baumaßnahmen freigelegt und dabei unmittelbarer Kontakt erfolgen würde“. Bisher wurden allerdings nur zwei von über 100 Sprengtrichtern untersucht.
Munition und Kampfmittel sind allerdings nur das eine Problem. Das andere betrifft das Thema Altlasten im Boden, also die Kontamination des Erdreichs mit Sprengstoff. Hier können zum Beispiel Belastungen des Grundwassers momentan weder ausgeschlossen noch bestätigt werden, erklärt Fritz. Gefahren für das Trinkwasser erkennt das Wasserwirtschaftsamt nicht (siehe Infokasten).
Trotzdem: „Das Ausmaß der Belastungen und der betroffenen Flächen hat uns schon überrascht“, erklärt Fritz. Zumal die Stiftung bisher damit gerechnet hatte, nur unmittelbar betroffene Flächen räumen zu müssen. „Das stellt sich leider jetzt anders dar.“ Heißt: Um eine großflächige Räumung des gesamten Geländes kommt man nicht herum. Damit sind weder die finanziellen noch die zeitlichen Folgen für den Bau des dritten, zentralen Gedenkortes abschätzbar. Neben der Klärung zahlreicher rechtlicher Fragen geht es auch um die Zusammenarbeit mit mehreren Behörden wie Landratsamt, Innen- und Umweltministerium und rund 30 Grundstückseigentümern.
Im nächsten Schritt soll nun ein Plan für die Kampfmittelräumung und Altlastensanierung ausgearbeitet werden. Außerdem gehe es da rum, eine finanziell tragbare Lösung zu finden. „Man wird sich aber auf jeden Fall einigen“, sagt Fritz. „Dank dem Engagement von Hans-Jochen Vogel und Max Mannheimer führt an der Realisierung kein Weg mehr vorbei.“

Mühldorf. – Am Bunkergelände wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Tausende Tonnen Munition gesprengt.
"Mit über 100 Sprengtrichtern befand sich im Mühldorfer Hart einer der größten Sprengplätze in Bayern, was die Anzahl betrifft", sagt Alexander Schwendner. Der Geologe beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der Rüstungsgeschichte in Bayern.
2600 TONNEN MUNITION GESPRENGT
Wer verstehen will, wie es überhaupt zu den massiven Problemen mit Kampfmitteln und Altlasten im Boden kommt, muss über 70 Jahre zurückblicken. Nach Kriegsende begannen US-Truppen damit, die verbliebene Munition zu sprengen. Ab Mitte 1946 war dann die Staatliche Erfassungsstelle für Öffentliches Gut (StEG) für die Aufarbeitung der Kampfmittel zuständig, die zu diesem Zweck 34 Entschärfungsstellen einrichtete. 20 davon lagen in Bayern. An den E-Stellen wurde die Munition unter schwierigen Arbeitsbedingungen zerlegt und entschärft (entzündet). Nach dem Entschärfen mussten die Sprengstoffe jedoch aus den Granaten und Bombenhüllen entfernt werden. Eines dieser sogenannten Delaborierungswerke befand sich in der ehemaligen Rüstungsfabrik im Werk Aschau.
Da ab Herbst 1947 sämtliche Eisenbahnwaggons zum Einfahren der deutschen Ernte benötigt wurden, sollte die restliche Munition gesprengt werden. Obwohl in Aschau mit Hochdruck in drei Schichten an der Auslaugung der Munition gearbeitet wurde, befanden sich im Herbst 1947 noch etwa 5600 Tonnen im Werk. Die Zeit drängte, da das Werk auf der „Reparationsliste“ stand und bis Ende 1947 geräumt werden musste.
Nachdem die StEG in Aschau im Frühjahr 1948 2900 Tonnen Munition nach Italien transportiert hatte, verblieben rund 2600 Tonnen. Da das Werksgelände aus Sicherheitsgründen nicht in Frage kam, transportierte die StEG die Munition zum Bunkergelände. „Auf Grund des großen Zeitdrucks mussten so viele Sprengtrichter parallel betrieben werden“, so Schwendner. „Es ist normal, dass bei solchen Mengen ein erheblicher Teil der Munition nicht detonierte, sondern mehrere Meter tief in den Boden der Sprengstellen gedrückt oder ein paar hundert Meter weit fortgeschleudert wurde.“
HOHER ZEITDRUCK, GROSSE MENGEN
Der wesentliche Teil der Vernichtungen war im Mai 1948 abgeschlossen. Bis zu ihrer Auslösung im Mai 1949 veranlasste die StEG die Sprengplätze aufzuräumen, von 1949 bis 1954 erfolgten weitere Räumungen in der Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr. „Die Räumungen waren jedoch nach heutigen Maßstäben unvollständig“, sagt Schwendner. Wie unvollständig, zeigte sich am Beispiel des Sprengplatzes in Marktbergel. Dort wurden von 2011 bis 2014 über 140 Tonnen Kampfmittel geräumt, 1500 Granaten waren in einem so gefährlichen Zustand, dass sie nicht abtransportiert sondern vor Ort gesprengt werden mussten. Ha
01.03.18
Tonnenweise Sprengstoff und Granaten im Boden
Die Behörden wissen seit Jahrzehnten Bescheid, unternommen haben sie bis heute nichts: Rund um das Bunkergelände im Mühldorfer Hart befinden sich tonnenweise gesprengte Granaten und Munition im Boden.
Welche Auswirkungen die Kampfmittel und die daraus resultierenden Altlasten auf die Umwelt haben und welche Gefahr davon ausgeht, ist im Detail noch nicht erforscht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf dem Gelände tausende Tonnen Munition vernichtet. Es handelte sich um einen der größten Sprengplätze in Bayern. Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Gedenkortes zur Erinnerung an die Opfer des KZ-Außenlagers sollen die über 100 ehemaligen Sprengtrichter nun geräumt werden. Die Höhe der Kosten ist noch nicht ermittelt. H
Kommentar: 01.03.18
Handlungsbedarf
Lange war das Thema Kampfmittel in der Diskussion um den Bau einer Gedenkstätte eine Randnotiz – überlagert von den Debatten um Zuständigkeiten, Finanzierung und Grundstücksfragen. Nun kommt ans Tageslicht, was die Behörden seit Jahrzehnten wussten.
Ende der 1990er-Jahre veranlasste das Bayerische Innenministerium eine Untersuchung der „Rüstungsaltlastenstandorte in Bayern“. Im Abschlussbericht, der der Heimatzeitung vorliegt, erhält das „Sprenggelände“ im Mühldorfer Hart mit einer Fläche von 24,80 Hektar die Priorität „A2 - kurzfristiger Handlungsbedarf“. Das war vor 18 Jahren.
Seitdem ist nichts geschehen. Kein Amt und kein Ministerium hat entscheidende Maßnahmen zur Verkehrssicherung oder zum Umweltschutz in die Wege geleitet. Wohl wissend, dass sie mit der Untätigkeit auch ein hohes Risiko eingingen. So hat den „Schwarzen Peter“ nun die Stiftung Bayerische Gedenkstätten, die an der Räumung des gesamten Geländes nicht vorbei kann.
Doch es greift zu kurz, den Bau der Gedenkstätte für das Dilemma um Kampfmittel und Altlasten im Boden verantwortlich zu machen. Sie mag der Anlass sein, Verursacher ist sie nicht. Das müssen alle Beteiligten im Blick haben, wenn sie bald über die hohen Kosten diskutieren, die nun zusätzlich anfallen werden. Denn „Handlungsbedarf“ besteht seit Jahrzehnten, auch wenn ihn lange niemand sehen wollte. (Wolfgang Haserer)
06.03.18
Landratsamt nimmt Stellung zu Altlasten
Mühldorf. – Das Mühldorfer Landratsamt hat Stellung zum Thema Altlasten im Mühldorfer Hart genommen.
„Wir nehmen Bezug auf eine im Mühldorfer Anzeiger erschienene Berichterstattung zum Thema Altlasten auf dem Gelände des Mühldorfer Hart am Donnerstag, 1. März. Den Landkreis trifft grundsätzlich keine Verkehrssicherungspflicht, vielmehr liegt diese bei der Bundesrepublik Deutschland und bei den Grundstückseigentümern. Eine Kampfmittelräumung des gesamten Geländes aus Gründen des Umweltschutzes war aufgrund bisher vorliegender Untersuchungsergebnisse nicht angezeigt“, erklärte Pressesprecherin Sandra Schließlberger.
Grundsätzlich wird aber angemerkt, dass das Landratsamt Mühldorf am Inn die zuständigen Stellen bei der Umsetzung der Gedenkstätte im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter unterstützt.
17.03.18
EIN HOLOCAUST-ZEITZEUGE ERZÄHLT
Kein Leben mit Hass im Herzen

Im Haberkasten lauschten etwa 100 Schüler der beruflichen Oberschule Inn-Salzach Altötting/Mühldorf gebannt und betroffen den Holocaust-Erinnerungen vom Überleben des Zeitzeugen Abba Naor.
Mühldorf – In den jungen Gesichtern der Zuhörer spiegelt sich das Grauen, das die 17 bis 19 jährigen Schüler bei dem Erlebnisbericht des fast 90-jährigen Juden Abba Naor, empfinden. Ergriffen hören sie, wie er von seiner Kindheit und Jugend während des Holocaust berichtet.
"In meiner Heimat Litauen ging es 1941 los mit der systematischen Vernichtung. Von 220 000 Juden im Land wurden in den ersten Kriegsmonaten 140.000 umgebracht." Mit ruhiger Stimme erzählt Naor weiter: "Die Menschen wurden mit den Synagogen zusammen verbrannt oder in den Wäldern erschossen."
Geboren am 21. März 1928 war Naor 13 Jahre alt, als ihn die Nazis mitsamt seiner großen Familie und 20.000 anderen Juden in Kaunas in ein Ghetto steckten. "Angst und Hunger wurden von da an für uns zur Normalität", sagt der alte, aber ungebeugte Herr im dunklen Anzug.
"Und ich konnte als Kind nicht verstehen, warum das alles passierte, warum uns die Nachbarn nicht halfen, warum wir mit einmal geächtet und verfolgt wurden – warum nur? Nur weil wir Juden waren? Ich verstehe es bis heute nicht." Nach einer kurzen Pause setzt er dazu: "Wir hatten doch niemandem etwas getan!"
Abba Naor berichtet bewegt, wie er seine Mutter und den kleinen Bruder zuletzt gesehen hatte. "Sie wurden in Auschwitz vergast, wie ich später erfuhr." Der ältere Bruder wurde erschossen, weil er Essbares für die Familie besorgen wollte. Naor erzählt erstaunlich gleichmütig von Menschenexperimenten, Krematorien, Gaskammern, Gruben voller Leichen und Vernichtungslagern in Polen. "Das war die Hölle. Obwohl: Von außen sah es direkt hübsch aus, sogar mit Blumenkästen vor den Fenstern." Als 16-Jähriger kam er nach Dachau in ein Außenlager. "Ich konnte arbeiten, deshalb durfte ich leben. Aber wie?" Nach zwölf Stunden unmenschlich harter Arbeit im Betonwerk Utting gab es eine Scheibe Brot und etwas Suppe für die ausgemergelten Menschen. "Die Schweine wurden besser ernährt als wir. Manchmal klauten wir ihnen unter Lebensgefahr eine Kartoffel."
Die Befreiung 1945 bekam er mit, weil "mit einmal die Wachen weg waren". Die Amerikaner kamen ins Lager, waren fassungslos über die Berge von Leichen, die fast verhungerten Menschen. "Es war wirklich grauenvoll."
Die Schüler fragen mit leisen Stimmen, was Abba Naor am Leben gehalten habe in dieser Zeit. "Die Hoffnung, meine Familie doch irgendwann wieder zu sehen. Sterben war zu leicht und das Leben zu schön, trotz allem!" Seelisch sei er nie befreit worden. "Ich habe alle gehasst, aber nur mit Hass im Herzen kann man nicht leben. Also habe ich irgendwann aufgehört, eine Familie gegründet, versucht, ein normales Leben zu führen."
Eine Schülerin will wissen: "Was war das schlimmste?" Postwendend die Antwort: "Der ständige Hunger!" Noch heute habe er immer zwei Kühlschränke voller Lebensmittel daheim.
28.03.18
KZ-GEDENKORTE AM EHEMALIGEN WALDLAGER UND MASSENGRAB
Historische Baustellen

Die beiden KZ-Gedenkorte am ehemaligen Waldlager und Massengrab im Mühldorfer Hart nehmen konkrete Formen an. Vier Wochen vor der Eröffnung lud die Stiftung Bayerische Gedenkstätten gestern zu einer Baustellenbesichtigung ein.
Mühldorf – Es rührt sich was im Wald: Lastwagen schaffen noch ein paar Ladungen Humus herbei, ein Bagger schaufelt und planiert. Hier, am nördlichen Rand des Mühldorfer Hart, sind die Arbeiten am KZ-Gedenkort "Waldlager" weit fortgeschritten. Die Betonplatten, auf denen die Besucher künftig vom Lager zum ehemaligen Appellplatz gehen sollen, sind ausgelegt und montiert. Was noch fehlt, ist die U-förmige Zugangsschleuse mit den Informationstafeln. "Doch bis 28. April wird alles fertig", verspricht Ulrich Fritz von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. "Ganz sicher."
Eine Bemerkung, die Eva Köhr vom Arbeitskreis Gedenkstätte Mühldorfer Hart und Erhard Bosch vom "Verein für das Erinnern" ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Denn lange, viel zu lange galt bei diesem Projekt nichts als sicher. Und auch jetzt, da die offizielle Eröffnung der ersten beiden Gedenkorte im Mühldorfer Hart unmittelbar bevorsteht, sind nach wie vor viele Fragen offen. Sie betreffen den dritten Gedenkort am Bunkergelände, die Altlasten und Kampfmittel im Boden (wir berichteten), die Eigentumsverhältnisse. "Alles sehr komplex", sagt Fritz – wohl wissend, dass da noch viel Arbeit auf ihn zukommt.
"Wir tun das hier wegen der historischen Bedeutung. Und nicht, weil wir fünfstellige Besucherzahlen erwarten." Ulrich Fritz
Doch davon wollte er sich gestern die Laune nicht verderben lassen. "Es ist eine gute Gelegenheit, sich nach all den Jahren auch einmal gegenseitig auf die Schultern zu klopfen." Jeder habe seinen Beitrag zur Realisierung der Gedenkorte geleistet – von den Bayerischen Staatsforsten als Grundstückseigentümerin am ehemaligen Waldlager und Massengrab über das staatliche Bauamt bis zum Arbeitskreis KZ-Gedenkstätte und dem "Verein für das Erinnern". Es sei schon bewundernswert, dass der Druck der Ehrenamtlichen nie nachgelassen habe, erklärt Fritz, "sondern immer stärker wurde. Irgendwann gab es dann einfach kein Zurück mehr."
Darüber hinaus profitiere man von den Ergebnissen der jahrelangen Forschungen und Recherchen zum KZ-Außenlager: "Mal ehrlich: Wir stehen hier mitten im Wald", sagt Fritz. "Was könnten wir schon erzählen, wenn wir kein so großes Wissen darüber hätten, was hier passiert ist?"
Dieses Wissen hat die NS-Dauerausstellung im Mühldorfer Haberkasten seit zwei Jahren gebündelt. Nun wird die Geschichte an den Gedenkorten stärker erfahrbar. "An den Zugangsschleusen vermitteln wir lediglich Basiswissen zum Bau der Rüstungsfabrik und zum jeweiligen Ort", sagt Fritz. "Wir wollen aber die Besucher hier im Wald nicht mit Informationen überfrachten."
So soll genügend Raum bleiben, die Gedenkorte für sich sprechen zu lassen: Den Bunkerbogen für den Gigantismus der Nationalsozialisten, das Waldlager für die unmenschlichen Lebensbedingungen der KZ-Häftlinge, das ehemalige Massengrab für die Vernichtung durch Arbeit. Über 2100 Häftlinge wurden hier verscharrt, in einem 63 Meter langen Graben. Nach dem Krieg wurden sie in Mühldorf, Neumarkt-St. Veit und anderen KZ-Friedhöfen beerdigt. Mannshoch geschnittene Bäume stehen symbolisch für das Sterben. Die Sieger des Architektenwettbewerbs, das Planungsbüro "Latz & Partner", haben einen künstlerischen Ansatz gewählt. Auch hier führt ein Betonsteg die Besucher an den Gedenkort heran, auch hier fehlt noch die Informationsschleuse. "Aber auch hier werden wir bis 28. April fertig", sagt Fritz. "Ganz sicher."
SZ, 3. April 2018, 05:20 Uhr
Das vergessene Lager
Im Mühldorfer Hart sollten KZ-Häftlinge eine riesige Flugzeugfabrik für das NS-Regime bauen. 73 Jahre später wird endlich eine Gedenkstätte eröffnet - nach jahrelangem Ringen mit dem Land Bayern.
Von Matthias Köpf, Waldkraiburg
Die Forstwege, die sich als lange Geraden durch den Wald ziehen, heißen "Ludwigslinie" oder "Maxlinie". Frauen mit Walking-Stöcken kommen hier entlang, ein Mann führt einen Hund spazieren. An der Kronprinzlinie weist ein Baustellenschild ganz sachlich einen anderen Weg: "Massengrab" steht auf der Tafel.
Denn hier im Mühldorfer Hart sollten noch im Sommer 1944 Tausende KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter eine riesige Flugzeugfabrik in den Waldboden betonieren und darin dann Düsenflieger vom Typ Me 262 montieren, von denen Hitler sich und den Deutschen doch noch den Endsieg versprach. So weit ist es nicht gekommen, und auch die Fabrik und eine ähnliche im schwäbischen Kaufering waren längst nicht fertig, als das Lager am 28. April 1945 evakuiert wurde. Doch allein das Massengrab im Mühldorfer Hart hatte sich gefüllt mit mehr als 2000 Toten. Hier und im ehemaligen Waldlager sollen Ende April die beiden ersten Erinnerungsorte einer dreiteiligen KZ-Gedenkstätte eröffnet werden.
DER FREISTAAT SAGTE 2,5 MILLIONEN EURO FÜR DIE GEDENKSTÄTTE ZU
Im Waldboden verankerte Stege aus Betonplatten werden dann den Ort des Massengrabs und den des Waldlagers erschließen. Eine überdachte "Schleuse" aus zwei großen Betonteilen wird den Zugang zur Gedenkstätte markieren und auf Abbildungen und Texttafeln Information und Orientierung bieten. Noch steht die Schleuse nicht, doch bald soll es so weit sein. "Wir haben es gehofft, aber nicht geglaubt", sagt Eva Köhr, die stellvertretende Landrätin war und bis heute Vorsitzende des "Arbeitskreises KZ-Außenlager Mühldorfer Hart" ist. Den Arbeitskreis, an dem sich auch staatliche Stellen beteiligen, gibt es seit 2010. Zuvor hatten sich einige Bürger, allen voran der Waldkraiburger Geschichtslehrer Peter Müller, für eine Gedenkstätte eingesetzt und 2002 den Verein "Für das Erinnern" gegründet.
Dann sollte es noch zehn Jahre dauern bis zur ersten Machbarkeitsstudie und zu dem Wettbewerb, dessen Siegerentwurf gerade gebaut wird. Zuvor waren wieder Jahre ins Land gezogen, in denen Bund und Land auf den jeweils anderen zeigten. Erst nachdem Max Mannheimer als einer der letzten Überlebenden des Lagers mit dem SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel 2015 bei Horst Seehofer vorgesprochen hatte, sagte der Freistaat 2,5 Millionen Euro für die Gedenkstätte zu. Dem Bund mangelt es für eine Förderung noch immer an "authentischer Bausubstanz".
IM DURCHSCHNITT ÜBERLEBTE EIN HÄFTLING HIER 80 TAGE
Dass sich 70 Jahre nach Kriegsende wenigstens der Freistaat aufgerafft hatte, liegt für Ulrich Fritz daran, "dass dieser Druck vor Ort da ist und auch nicht nachgelassen hat". Fritz betreut das Projekt für die staatliche Stiftung Bayerische Gedenkstätten und erläutert das Konzept. Das setzt für detaillierte Informationen auf die Dauerausstellung, die Landkreis und Stadt 2015 im Mühldorfer Haberkasten eingerichtet haben. Im Hart beschränke man sich aus Pragmatismus auf drei je mehr als einen Kilometer voneinander entfernte Orte, obwohl sich weit verstreut Gruben, Wälle oder Betonteile finden.
Von selbst erschließt sich davon kaum etwas, auch die Reste des Waldlagers nicht. Hier mussten die Häftlinge Erdhütten ausheben aus einem tieferen Mittelgang, zwei Liegeflächen mit Brettern und darüber einer hölzernen Giebelkonstruktion. Bis zu 30 Menschen zwangen die Schergen in so eine Hütte. Viele starben an Krankheiten, am Hunger und an der vernichtend harten Arbeit. Weitaus die meisten Häftlinge dieses dem KZ Dachau zugeordneten Lagers waren ungarische Juden. Im Durchschnitt überlebte ein Häftling hier 80 Tage, wie es Peter Müller in einem seiner Bücher dargestellt hat. Von ungefähr 8300 KZ-Häftlingen kamen etwa 4000 hier um, und auch bei den rund 1700Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern gab es Hunderte Tote.
DER SCHWIERIGSTE ORT IST DER FABRIKBUNKER SELBST
Zur Frage, wie viele Menschen im Massengrab verscharrt wurden, gibt es unterschiedliche Listen, 2100 waren es aber mindestens. An der Stelle haben Staatsförsterin Monika Löffelmann und ihre Waldarbeiter vor zwei Jahren eine Lichtung ausgeholzt und dabei die Stämme der Fichten etwa in Mannshöhe schräg abgeschnitten. So habe man "etwas schaffen wollen, das verstört", sagt Ulrich Fritz. Dass der Ort wirkt und der Trauer Raum gibt, kann Erhard Bosch bestätigen. Er ist zweiter Vorsitzender des Vereins für das Erinnern und hat schon Schulklassen hierher geführt, aber auch Überlebende und Nachkommen, die sich "zutiefst beeindruckt" gezeigt hätten. Die Toten liegen nicht mehr hier, sondern auf KZ-Friedhöfen in der Umgebung. Lokale NSDAP-Mitglieder mussten sie umbetten, zum Entsetzen der Menschen, für die nun nicht mehr zu leugnen war, was die meisten geahnt, viele gewusst und nicht wenige aktiv unterstützt hatten.
Der schwierigste Ort ist der Fabrikbunker selbst. 400 Meter lang und 33 Meter breit hätte er werden sollen, halb unter der Erde, acht Etagen unter zwölf riesigen Betonbögen. Sieben davon wurden fertig, und der siebte widerstand später der Sprengung, weil ihn noch der Kiesberg hielt, über den er betoniert worden war. Moos und Bäume krallen sich in diesen Bogen wie in die am Boden verkeilten Trümmer der anderen.
Es ist ein Täter-Ort, der immer noch durch seine Monumentalität beeindruckt. Der Steg der Gedenkstätte soll hier in die Höhe führen, damit die Besucher nicht zu dem Bogen aufschauen müssen. Er wird nicht vor 2020 fertig werden, denn der Boden ist nicht nur voller Scherben und anderer Partyreste, sondern auch voller Altlasten. Die Bögen fällten die Amerikaner mit 110 Tonnen TNT, außerdem wurden hier später Munitionsvorräte gesprengt. Das Gelände gehört zwei Dutzend Privateigentümern, es wird über Tauschgeschäfte verhandelt. Auch nach der Eröffnung am Waldlager und am Massengrab Ende April ist der Weg hier noch weit.
23.04.18
ERÖFFNUNG DER GEDENKORTE IM MÜHLDORFER HART
Ein Hauch Genugtuung

Elke und Günther Egger in den 1980er Jahren zahlreiche Anfragen an Ministerien und Behörden verschickt. ha
Elke und Günther Egger haben vor drei Jahrzehnten die erste Gedenkveranstaltung am Bunkergelände im Mühldorfer Hart organisiert. Wenn am kommenden Freitag die Gedenkorte am ehemaligen Massengrab und am Waldlager eingeweiht werden, erfüllt sie das mit Freude – und ein wenig Genugtuung.
Mühldorf – "Viele waren wir nicht", sagt Günther Egger. Damals, 1987. "Vielleicht fünf oder sechs Leute. Vielleicht auch ein paar mehr." Und doch war das, was sich vor 31 Jahren im Mühldorfer Hart abspielte, ein besonderes Ereignis. Die Friedensinitiative im Landkreis um Elke und Günther Egger hatte zur ersten Gedenkveranstaltung für die NS-Opfer des KZ-Außenlagers Mühldorf aufgerufen. An mehreren Stationen des Gedenkmarsches wurden Texte vorgelesen und Gebete gesprochen. "Wir wollten der Toten gedenken", erzählt Günther Egger. "Und wir wollten das Thema noch mehr in die breite Öffentlichkeit bringen." Denn dort, in der breiten Öffentlichkeit, war es noch lange nicht angekommen. "Der großen Masse war das alles schlicht egal."
Immerhin: Erste Ansätze für eine nachhaltige Erinnerungsarbeit gab es bereits: Rainer Ritzel und Josef Wagner hatten gerade den Film "Mit 22 Jahren wollte man noch nicht sterben" gedreht, Peter Müller hielt vereinzelt Vorträge über die Geschichte des Bunkergeländes und des KZ-Außenlagers.
So waren auch Elke und Günther Egger auf das Thema aufmerksam geworden: "Peter Müllers Vortrag im Jugendzentrum im alten Schützenhaus hat uns damals die Augen geöffnet." Der Bericht über das Leiden und Sterben der Häftlinge habe ihn mit voller Wucht getroffen, erzählt Günther Egger. "Ich stand ja kurz vor dem Abitur, hatte Leistungskurs Geschichte und dachte, ich wüsste gut über die NS-Zeit Bescheid. Doch an diesem Abend stellte sich heraus, dass ich keine Ahnung davon hatte, was sich im Dritten Reich hier vor Ort abgespielt hat."
Also gründeten Elke und Günther Egger zusammen mit weiteren Mitstreitern den Verein "Geschichtswerkstatt Mühldorf" – zwei Jahrzehnte, bevor der "Verein für das Erinnern" seine Arbeit aufnahm. Das Engagement, das die Werkstatt-Mitglieder an den Tag legten, lässt sich bis heute auf der Homepage der Geschichtswerkstatt nachvollziehen. "Wir haben in Archiven gewühlt, lange bevor man E-Mail-Anfragen stellen oder im Internet recherchieren konnte." Dabei beleuchteten Egger & Co. Themen, über die bis dahin wenig oder gar nichts bekannt war: Sie veröffentlichten Berichte über die ermordeten Pfleglinge der Behindertenanstalt Ecksberg; schrieben über die Schicksale der Juden, die in Mühldorf gelebt haben; erklärten, was es mit den Todesmärschen durch den Landkreis auf sich hatte. Alles mündete in eine Publikation, die 2001 im Selbstverlag erschienen ist: "Der Landkreis Mühldorf im Nationalsozialismus."
Auch politisch mischten sich die Eggers ein. Über Jahre hielten sie die Diskussionen um das am Bunkergelände gelagerte Giftgas am Laufen. Außerdem saß Elke Egger von 1990 bis 2002 im Mühldorfer Stadtrat.
Vieles, was damals ans Tageslicht kam, findet sich heute in der NS-Dauerausstellung im Mühldorfer Haberkasten wieder. "Eine gute Ausstellung. Pflichtprogramm für Jedermann", sagt Günther Egger, der mit Blick auf die Eröffnung der ersten Gedenkorte am Freitag "vor allem viel Freude und ein klein wenig Genugtuung" verspürt. "Besonders gegenüber denjenigen, die uns damals als Nestbeschmutzer beschimpft haben." Zu Angriffen, Drohbriefen oder Beleidigungen sei es glücklicherweise nie gekommen: "Es wurde kontrovers diskutiert. Aber es ging nie unter die Gürtellinie."
Auch wenn die Geschichtswerkstatt als Verein noch existiert, ruht das Engagement von Elke und Günther Egger seit Jahren. Was nicht heißt, dass die beiden das Thema aus den Augen verloren haben. "Wir sind immer noch sehr interessiert und werden ganz sicher auch zur Eröffnung der Gedenkorte gehen."
ovb, 27.04.18
ERÖFFNUNG DER GEDENKORTE AM MASSENGRAB UND WALDLAGER IM MÜHLDORFER HART
Ein sichtbares Zeichen im Wald

Mit einem Festakt und einer Begehung eröffneten gestern Vertreter der Politik, von Vereinen und der jüdischen Gemeinde die ersten beiden Gedenkorte des KZ-Außenlagers Mühldorf. Auch sechs Überlebende waren dabei.
Mühldorf – Wer ermessen will, welche Bedeutung der gestrige Tag hatte, musste nur ins Gesicht von Andor Stern schauen. Immer wieder rieb sich der 90-Jährige bei seinem Gang durch das ehemalige Waldlager die Tränen aus den Augen. Immer wieder fotografierte er mit einer kleinen Kamera die Mulden im Boden; dokumentierte die letzten Überreste der Erdhütten, in denen die Gefangenen hausten. Er nahm die Informationstafeln auf, die Bäume, die heute auf dem Appellplatz stehen, die neuen, langen Betonwege im Wald südlich von Ampfing. Und immer wieder kamen ihm die Tränen.
Stern ist einer von sechs Überlebenden, die gestern an der Eröffnung der Gedenkorte teilnahmen. Nicht nur für sie ging damit ein langer Weg vorläufig zu Ende, auf dem Ehrenamtliche und Politiker seit Jahren unterwegs sind. "Wir schulden diesen Ort den Toten und den Überlebenden", sagte Karl Freller, Direktor der Stiftung bayerischer Gedenkstätten.
An drei Plätzen soll an die Leiden von mehr als 8000 zumeist jüdischen Ungarn erinnert werden, die von Juli 1944 bis zum 28. April 1945 in der Rüstungsfabrik Weingut I arbeiten mussten: Im Waldlager, in dem die Arbeiter-Erdhütten untergebracht waren. Am ehemaligen Massengrab, aus dem die Alliierten 1945 und 1946 die Leichen exhumieren und auf umliegenden KZ-Friedhöfen bestatten ließen; und am Bunkerbogen, dem eindrucksvollsten Zeichen des Nazi-Rüstungswahns. Der Weg zum dortigen Gedenkort ist aber noch weit (siehe Artikel links). Systematisch aufgearbeitet wird die NS-Geschichte im Kreismuseum.
Die Gedenkstätte ist vor allem mit zwei Namen verbunden: Hans-Jochen Vogel und Max Mannheimer. Sie überzeugten auf Einladung von Dr. Marcel Huber im Juli 2015 den damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer von der Notwendigkeit des Erinnerns im Landkreis. Einen Tag später fiel der Beschluss zur Finanzierung.
Für den ehemaligen Häftling Mannheimer, den unermüdlichen Mahner für Erinnerung und Versöhnung, kam die Eröffnung zu spät. Er starb vor knapp zwei Jahren. Trotzdem war er gestern präsent, auch Charlotte Knob loch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Oberbayern, erinnerte an ihn: "Max Mannheimer hat den Kampf gegen das Vergessen angenommen und ihn auch gewonnen."
"Ich hoffe, dass ich die Einweihung des dritten Gedenkortes noch erlebe." H.-J. Vogel
Der 92-Jährige Vogel ließ sich sichtlich gerührt im Rollstuhl durch die Gedenkorte schieben. Am Rednerpult im Kino Waldkraiburg rief er dann in beeindruckender Weise dazu auf, die Grundwerte der Demokratie gegen einen sich radikalisierenden Nationalismus und gegen Antisemitismus zu verteidigen: "Das ist die Pflicht jedes Einzelnen. Das betrifft nicht nur die da oben."
Neben Innen-Staatssekretär Stephan Mayer ("Die Gedenkstätte ist ein Stachel im Fleisch unseres Bewusstseins") stellte auch Kultusminister Bernd Sibler die Eröffnung in den zeitlichen Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten Wochen: "Wir setzen heute auch ein Zeichen mit Blick auf den Antisemitismus, der in Deutschland gerade wieder aufflackert. Das 'Nie wieder!' darf nicht nur in Worten gesprochen, es muss auch gelebt werden." Dafür setzen sich seit Jahren der "Verein für das Erinnern" und der "Arbeitskreis KZ-Außenlager Mühldorfer Hart" ein. Deren Vorsitzende Franz Langstein und Eva Köhr versprachen, das "Netz der Erinnerung" in der Region weiterzuspinnen.
Das letzte Wort des Festakts gehörte den Überlebenden. Mordechai Gidron erzählte von seinen Albträumen aus dem Lager, in denen nur schemenhafte Figuren ohne Namen und Gesichter auftauchen. "Die Menschen waren damals nur Hintergrund." Gestern rückten sie ein entscheidendes Stück nach vorne.
In der Montagsausgabe stellen wir die Gedenkorte auf einer Sonderseite vor.
ovb, 28.4.2018
Erfolg einer breiten Bewegung
Kommentar: Wolfgang Haserer
Gestern war – so seltsam das im Zusammenhang mit der Einweihung einer KZ-Gedenkstätte klingt – ein Tag der Freude.
Denn die Eröffnung der ersten beiden Dokumentationsorte im Mühldorfer Hart zeigt, was ehrenamtliches Engagement bewirken kann.
Seit Jahrzehnten setzen sich Überlebende, Vereine und Institutionen für das Gedenken und die Erinnerung an die Opfer der Mühldorfer KZ-Außenlager ein. Dank ihnen kamen viele Details über dieses grausame Kapitel der Geschichte ans Licht, das nicht irgendwo geschrieben wurde, sondern im Wald vor unserer Haustür. Dort erfahren Besucher und Spaziergänger nun endlich, was unter dem Bunkerbogen, im Waldlager und am Massengrab geschehen ist. Gerade noch rechtzeitig, bevor zu viel Gras über die Sache wächst.
Die Liste derer, die sich unermüdlich für die Erinnerungsarbeit eingesetzt haben, ist lang – zu lang, um an dieser Stelle auch nur die Wichtigsten zu nennen. Sie alle haben dafür gesorgt, dass das Engagement über Jahrzehnte nicht zurückging, sondern immer weiter wuchs; dass die Basis trotz vieler Rückschläge nicht schmaler, sondern immer breiter wurde; und dass sich die Politik auf Kreis-, Landes- und Bundesebene am Ende nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung für die Realisierung einsetzte. Und sie alle werden nicht locker lassen, bis auch die Bunkerruine ein Gedenkort ist.
Einer fehlte gestern: Max Mannheimer. Dass er die Einweihung nicht mehr erleben durfte, trübt die Freude. Sein Credo: "Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht." Auch dafür stehen die Gedenkorte.
ovb, 27.04.18
Hoffnung für den Bunkerbogen
Mühldorf. – Von großen Fortschritten für eine dritte Gedenkstätte am Rüstungsbunker sprach Kultusstaatssekretär Bernd Sibler gestern im Mühldorfer Hart.
Vor allem zwei Probleme gibt es beim Kernstück der Erinnerungsorte: die Finanzierung und die Entsorgung von Kampfmitteln und Sprengstoffen, die dort nach dem Krieg vernichtet wurden und noch im Boden liegen.
Auf Nachfrage gab sich Umweltminister Dr. Marcel Huber zurückhaltend. Der Ampfinger CSU-Landtagsabgeordnete führt die Verhandlungen mit den 60 Grundstückseigentümern, die von der Sanierungsmaßnahme und dem Bau einer Gedenkstätte betroffen sind. Sowohl die Frage der Entsorgung von Sprengstoffen wie auch der Grundstücksübertragung an die Gedenkstättenstiftung sei "auf einem sehr guten Weg", sagte Huber. Die Gespräche mit den Eigentümern seien weit fortgeschritten. Für die Frage der Finanzierung – im Raum stehen mehrere Millionen Euro – werde es eine Klärung zwischen Bund und Freistaat geben.
Zuletzt hatte es schlechte Nachrichten aus Berlin gegeben, der Bund hatte zum zweiten Mal einen Förderantrag für die Gedenkstätte abgelehnt – mit der Begründung, das Bunkergelände besitze aufgrund mangelnder Authentizität keine nationale Bedeutung. An dieser Entscheidung einer Expertenkommission um Staatsministerin Professor Monika Grütters übten gestern nicht nur der "Verein für das Erinnern" und der "Arbeitskreis KZ-Außenlager Mühldorf" deutliche Kritik, sondern auch Innen-Staatssekretär Stephan Mayer. "Ich habe kein Verständnis dafür, dass diesem Ort die nationale Bedeutung abgesprochen wird." Deshalb soll das Gremium möglichst bald in den Landkreis kommen. ha/hon
STIFTUNG BAYERISCHE GEDENKSTÄTTEN
Gedenkorte im Mühldorfer Hart der Öffentlichkeit übergeben

Gegen das Vergessen: Gemeinsam mit Überlebenden wurden die Gedenkorte "Waldlager" und "Massengrab" des KZ-Außenlagers im Mühldorfer Hart eröffnet. Besucher können sich nun am historischen Ort über das grausame Schicksal der Zwangsarbeiter informieren und so die Erinnerung an die Opfer bewahren.
"Die Erinnerung an die Opfer der KZ-Außenlager im Mühldorfer Hart hat nun weithin sichtbare Anlaufpunkte. Mit zwei Gedenkorten stemmen wir uns hier gegen das Vergessen!", betonte Kultusminister Bernd Sibler in Waldkraiburg. Dort übergab er in Vertretung für Ministerpräsident Dr. Markus Söder gemeinsam mit Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, und Überlebenden die Gedenkorte "Waldlager" und "Massengrab" des KZ-Außenlagers Mühldorf der Öffentlichkeit.
Am Festakt nahmen Überlebende der Mühldorfer Lager sowie Vertreter des Arbeitskreises KZ-Außenlager Mühldorfer Hart und des Vereins "Für das Erinnern" teil, die durch ihre langjährigen ehrenamtlichen Vorarbeiten den Weg für die eingeweihten Gedenkorte bereitet hatten.
"'NIE WIEDER' MUSS MEHR ALS SELBSTVERSTÄNDLICH SEIN"
Kultusminister Bernd Sibler erklärte: "Die Aufgaben, die diese Gedenkorte uns heute vorgeben, sind eindeutig: Unsere freiheitliche, auf die unveräußerlichen Menschenrechte gegründete demokratische Ordnung garantiert uns seit drei Generationen Frieden und Freiheit – diese Ordnung müssen wir schützen! Das 'Nie wieder' muss für uns mehr als selbstverständlich sein. Jeder menschenverachtenden Ideologie müssen wir den Kampf ansagen!"

Die beiden Gedenkorte sind Teil eines weitläufigen Areals, das im Sommer 1944 als zweitgrößter Außenlager-Komplex des Konzentrationslagers Dachau errichtet wurde. Dort sollte ein gigantischer halbunterirdischer Bunker für die Rüstungsindustrie entstehen. Für die Bauarbeiten wurden Tausende von Zwangsarbeitern nach Mühldorf verschleppt, darunter 8.300 KZ-Häftlinge. In nur zehn Monaten bis April 1945 kam fast die Hälfte der meist jüdischen Häftlinge ums Leben.
Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Dr. h.c. Charlotte Knobloch, dankte dem Freistaat Bayern für das Engagement wider das Vergessen: "Das ist gerade heute, da es in gewissen Kreisen en vogue geworden ist, lauthals unsere Geschichte zu relativieren oder umzudeuten von elementarer Bedeutung." Knobloch appellierte daran, die Lehren aus der Geschichte ernst zu nehmen: "Es ist an jedem Einzelnen Antisemitismus und andere Formen der Menschenverachtung in allen Formen zu benennen, zu ächten und zu bekämpfen."
RELIKTE ÜBER BESUCHERWEG AUS NÄCHSTER NÄHE SICHTBAR
Überlebende, Vereine und Institutionen hatten sich seit Langem dafür eingesetzt, die Erinnerung an die Mühldorfer KZ-Außenlager zu bewahren. Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten hat nun mit Mitteln des Freistaats die Realisierung von zwei der insgesamt drei Gedenkorte an den wichtigsten historischen Arealen im Mühldorfer Hart abgeschlossen.
Stiftungsdirektor Karl Freller betonte: "Die Erinnerung an die Verbrechen in den Konzentrationslagern wandelt sich, wenn keine Zeitzeugen mehr unter uns sind. Dann wird es wichtiger denn je sein, an den historischen Orten über das damalige Geschehen zu informieren und an die Opfer zu erinnern. Dafür haben wir hier im Mühldorfer Hart mit zwei eindrücklichen Dokumentationsorten den Grundstein gelegt." Gerade an den Orten ehemaliger KZ-Außenlager habe die Stiftung Bayerische Gedenkstätten in den letzten Jahren ihr Engagement verstärkt, so Freller.
Die Relikte des Waldlagers, in dem über 2.000 männliche und weibliche Häftlinge in provisorischen Erdhütten untergebracht waren, sind nun erstmals für Besucher über einen fest installierten Weg aus nächster Nähe sichtbar. In einem Informationsraum am ehemaligen Hauptzugang des Lagers geben Texte und Bilder Auskunft über den gesamten Lagerkomplex und das Waldlager. Zitate von ehemaligen Häftlingen vermitteln entlang des Besucherweges, was es bedeutete, in diesem Lager ums Überleben kämpfen zu müssen. Der zweite Gedenkort befindet sich am Massengrab. Über 2.200 Tote waren hier notdürftig verscharrt und wurden nach Kriegsende auf Friedhöfen in der Umgebung beigesetzt. Auch dieser Gedenkort ist nun mit einem Informationsraum und einem festen Besucherweg versehen.
IN PLANUNG: GEDENKORT RÜSTUNGSBUNKER
Als letztes und bedeutendstes historisches Areal soll der ehemalige Rüstungsbunker zum Gedenkort gestaltet werden. Der Bunker, der bei Kriegsende nicht fertiggestellt war, wurde nach dem Krieg gesprengt, lediglich ein gigantischer Bunkerbogen blieb stehen. Im Umfeld der Bunkerruine wurden nach dem Krieg Sprengmittel und Kriegsmunition gesprengt. Diese Kampfmittel müssen erst beseitigt werden, bevor der Gedenkort für Besucher gefahrenfrei zugänglich gemacht werden kann. Die Architekten sehen vor, am gesprengten fünften Bunkerbogen einen Besuchersteg auf die Ruine zu führen, von dem sowohl ein Blick über das gigantische Trümmerfeld wie auch zum stehenden Bogen möglich ist. Zentrales Anliegen ist es, den Besuchern die schrecklichen Entstehungsbedingungen dieses technisch ambitionierten Bauwerks zu verdeutlichen.
Die Gedenkorte sind nun für die Öffentlichkeit zugänglich.
22.6.2018, ovb
KAMPFMITTELRÄUMUNG AM BUNKERGELÄNDE
Die Rechnung geht an den Bund

Bis Ende 2020 soll die Kampfmittelbeseitigung am Bunkergelände im Mühldorfer Hart abgeschlossen sein. Außerdem geht das Bayerische Innenministerium davon aus, dass der Bund die Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro übernimmt.
Mühldorf – In der vergangenen Woche hatte der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags beschlossen, fünf Millionen Euro zur Beseitigung der Kampfmittel am Bunkergelände im Mühldorfer Hart bereitzustellen (wir berichteten). Nach aktuellem Stand soll die Kampfmittelräumung im zweiten Quartal 2019 beginnen und bis Ende 2020 dauern. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage der Heimatzeitung mit.
Zunächst ist das Landratsamt Mühldorf gefordert, die Einverständniserklärungen der Grundeigentümer einzuholen. Anschließend schreibt das Innenministerium die erforderlichen Leistungen aus und vergibt erste Aufträge. Ob die fünf Millionen Euro für die Beseitigung der Kampfmittel und Altlasten ausreichen werden, ist offen. "Die Summe basiert auf den Berechnungen des Ingenieurbüros, das mit der Untersuchung des Geländes beauftragt war", erklärt Ulrich Fritz von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, die am Bunkergelände einen weiteren Gedenkort plant. In diesem Zusammenhang waren die Bodenuntersuchungen des Staatlichen Bauamt Rosenheim nötig gewesen. Dabei wurden unter anderem Bombensplitter, Granaten und TNT-Reste entdeckt.
Unterdessen geht man im Bayerischen Innenministerium davon aus, dass der Bund die Kosten für die Kampfmittelräumung übernehmen wird. Dabei verweist der Ministeriums-Sprecher auf die gültige Rechtslage: "Der Bund erstattet die Aufwendungen der Länder für die Beseitigung unmittelbarer Gefahren für Leib und Leben durch ehemals reichseigene Kampfmittel im Rahmen eines Kostenerstattungsverfahrens." Die Verfahrensunterlagen würden derzeit erarbeitet. "Aufgrund der Gegebenheiten beim Sprengplatz Mühldorfer Hart gehen wir davon aus, dass die Kosten der Kampfmittelräumung vom Bund im Rahmen eines solchen Verfahrens erstattet werden."
Das Bunkergelände war nach dem Krieg als riesiger Sprengplatz genutzt worden, auf dem in über 100 Sprengtrichtern Tausende Tonnen ehemals reichseigener Munition vernichtet wurden. Die Beseitigung der Munition und Kampfmittel ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung der dritten Gedenkstätte am Bunkerbogen.
Die israelische Generalkonsulin Sandra Simovich für Süddeutschland besuchte am 11.1.2018 die NS-Ausstellung im Haberkasten
Fotos: Dr. Erhard Bosch

Frau Simovich beim Eintrag in die Besucherbücher des Landkreises, der Stadt Mühldorf und des Museums. Bürgermeisterin Marianne Zollner und Landrat Huber schauen interessiert über die Schulter.

Vor dem Medientisch von links: Marianne Zollner, Eva Köhr, Museumsbetreuer Roth, Generalkonsulin Simovich und ihr Mitarbeiter Tobias Kurzmaier, sowie Staatsminister Marcel Huber. Im Hintergrund Landrat Huber.
Artikel der ANA zum Besuch von Frau Simonich:

ovb-Artikel zum selben Thema:
